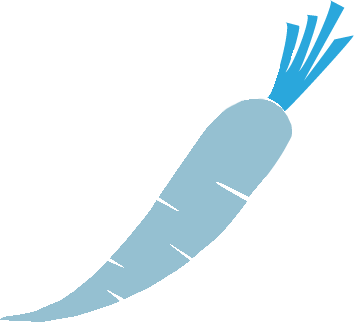Der Traum vom eigenen Foodbusiness
Immer mehr Menschen träumen davon, ihr eigenes Foodbusiness zu gründen. Sei es ein Foodtruck, ein Café, ein Restaurant oder die Herstellung handwerklich hergestellter Lebensmittel. Der Gedanke, das eigene Lieblingsgericht zu verkaufen oder ein besonderes Produkt auf den Markt zu bringen, ist verlockend.
Doch der Weg von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung ist voller Herausforderungen. Besonders im Lebensmittelbereich, wo rechtliche und hygienische Vorgaben eine zentrale Rolle spielen. Deshalb lohnt es sich, möglichst früh einige Aspekte abzuklären.
Welche Bewilligungen brauchst du für dein Foodstartup?
Je nach Geschäftsidee benötigst du unterschiedliche Bewilligungen. Dazu können gehören:
- je nach Kanton eine Gastgewerbebewilligung (für Restaurants, Cafés, Foodtrucks)
- Bewilligung für den Handel mit Alkohol
- Betriebsbewilligung für die Herstellung von bestimmten tierischer Lebensmittel
- Bewilligung bestimmter Zutaten (Novel Foods) oder Zusatzstoffe
Informiere dich frühzeitig bei deiner kantonalen Lebensmittelbehörde, um böse Überraschungen zu vermeiden. Ein guter Ausgangspunkt ist kantonschemiker.ch.
Startup-Gründung im Lebensmittelbereich: Die wichtigsten Grundlagen
Neben den produktspezifischen Anforderungen musst du dich auch mit allgemeinen Themen der Unternehmensgründung befassen:
- Welche Rechtsform passt zu deinem Foodbusiness?
- Welche Versicherungen brauchst du für dich und deine Mitarbeitenden?
- Musst du dich bei der Mehrwertsteuer anmelden?
- Wo ist der beste Standort für deinen Betrieb?
- Verkaufst du vor Ort, mobil oder über einen Webshop?
Es ist nicht ganz einfach, hier den Überblick zu behalten. Aber wenn du Schritt für Schritt vorgehst, wirst du das alles schaffen.
Das Herzstück deines Foodbusiness: Das Selbstkontrollkonzept (HACCP)
Egal, ob du Marmelade herstellst, Streetfood verkaufst oder ein Restaurant führst, jeder Lebensmittelbetrieb in der Schweiz benötigt ein risikobasiertes und betriebsangepasstes Selbstkontrollkonzept nach dem HACCP-Prinzip (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dieses Konzept dokumentiert, wie du die Lebensmittelsicherheit und Hygiene in deinem Betrieb sicherstellst. Bei einer Kontrolle musst du es vorweisen können. Zudem müssen sich alle Lebensmittelbetriebe in der Schweiz zumindest bei der Lebensmittelkontrolle melden.
Warum ein gutes Selbstkontrollkonzept Gold wert ist
- Du erkennst Risiken frühzeitig und vermeidest Rückrufe oder Beanstandungen.
- Du arbeitest effizienter, weil Prozesse klar geregelt sind.
- Du wirkst professionell gegenüber Kunden, Lieferanten und Behörden.
- Du bist vorbereitet, wenn du skalierst oder neue Absatzkanäle erschliesst.
Ein durchdachtes Selbstkontrollkonzept spart dir langfristig Zeit, Stress und Geld. Es ist eine Investition in Qualität und Nachhaltigkeit.
Häufiger Fehler: Erst Marketing, dann Kontrolle
Viele Gründer:innen konzentrieren sich anfangs auf das Branding und Social Media, dabei vergessen sie die lebensmittelrechtlichen Grundlagen. Doch wenn du plötzlich mehr Reichweite und Bestellungen hast, kann der fehlende rechtliche Unterbau schnell zum Problem werden.
Tipp: Kümmere dich schon in der Anfangsphase um dein Selbstkontrollkonzept. Dann kannst du wachsen, ohne ständig „nachbessern“ zu müssen.
Anforderungen steigen mit der Zeit
Auch wenn bei der ersten Inspektion der alles „paletti“ war: Mit wachsendem Umsatz oder Produktportfolio steigen die Anforderungen der Lebensmittelkontrolle. Zudem erwarten viele professionelle Abnehmer (z. B. Detailhändler, Grosshändler) deutlich mehr als nur gesetzliche Mindeststandards.
Darum lohnt es sich, dein Konzept regelmässig zu prüfen, zu aktualisieren und an neue Prozesse anzupassen.
So erstellst du dein Selbstkontrollkonzept Schritt für Schritt
Wenn du wissen möchtest, wie du in 8 Schritten ein betriebsangepasstes, risikobasiertes Selbstkontrollkonzept erstellst, lies unseren Folgeartikel: „In 8 Schritten zu deinem Selbstkontrollkonzept“. Dort erfährst du, welche Punkte du konkret dokumentieren musst, von der Hygiene über Rückverfolgbarkeit bis zur Etikettierung.
Ein Selbstkontrollkonzept sollte immer ein Arbeitsdokument sein. Eine Anleitung, die dir hilft, deine Lebensmittel sicher und in guter Qualität zu halten. Selbstkontrollkonzepte, die in der Schublade liegen bleiben, sind verlorene Zeit. Du hast einen Aufwand mit ihnen und kannst nicht vom Nutzen profitieren. Lässt du dich aber wirklich darauf ein, hilft es dir die Gefahren im Zusammenhang mit deiner Geschäftstätigkeit zu erkennen, zu minimieren und manchmal sogar zu eliminieren. Leider wirst du diesen Nutzen nicht haben, wenn du die (vermeintliche) Abkürzung nehmen wirst, ein Konzept von jemanden kopierst oder eine Branchenleitlinie unverändert und ungeschaut im Schrank ablegst. Wichtig ist die Auseinandersetzung. Nur die bringt dich weiter.
Nützliche Hilfsmittel und Vorlagen
Auf den Websites der kantonalen Lebensmittelbehörden findest du zahlreiche kostenlose Merkblätter, Checklisten und Vorlagen. Diese sind über kantonschemiker.ch abrufbar. Wähle deinen Kanton, um direkt auf die passenden Ressourcen zuzugreifen.
Achte darauf, dass die Vorlagen praxisnah und auf deinen Betrieb abgestimmt sind, denn ein Konzept, das niemand benutzt, ist wertlos.
Gesetzeskonformität und Qualität sind dein Wettbewerbsvorteil
Ein durchdachtes Selbstkontrollkonzept ist keine lästige Pflicht, sondern dein Schlüssel zu einem sicheren, professionellen und skalierbaren Foodbusiness. Wenn du es als Arbeitsinstrument nutzt, profitierst du täglich davon und dein Betrieb bleibt langfristig stabil und erfolgreich.